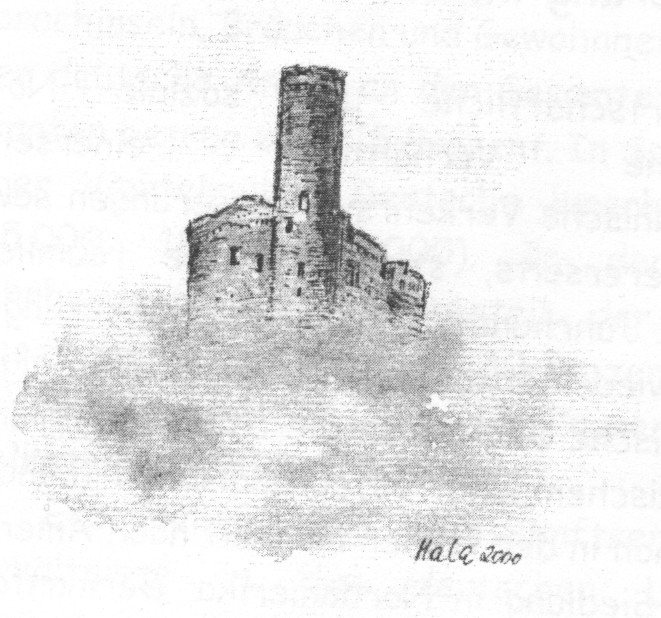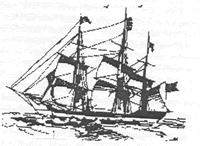Am 23.7.1842 (Bd. 15, S. 11) wurde eine Philippine Greef, Tochter des Leinewebers Andreas Greef aus Holzheim und Philippine Müller, Tochter des Johannes aus Holzheim geboren. Aufgrund der Altersangabe könnte es sich um Philippine Graf zu handeln. Sie war ledig.
Margarethe Böhler, geb. Seibel – Auswanderungsjahr 1851
Margarethe Seibel, geb. am 14. 04. 1830 (Bd. 5, S. 40) in Holzheim war die Tochter von Caspar Seibel und Anna Margarethe Müller aus Holzheim und heiratete am 14. 03. 1852 in den USA den aus Ketternschwalbach stammenden Johann Philipp Böhler, geb. am 7. 11. 1823.
Mohr – Auswanderungsjahr 1851
Es gibt in dem betreffenden Zeitraum nur einen in Frage kommenden “Mohr”. Dies ist Conrad Mohr (*10.9.1799 in Holzheim, Bd. 6, S. 145). Für ihn gibt es auch keinen Sterbe-Eintrag in den Kirchenbüchern. Ob er ausgewandert ist, geht nicht aus den Kirchenbüchern hervor. Er hatte keine Geschwister.
Conrad Mohr heiratete im Juli 1822 in Heistenbach (Bd. 36, S. 7) Anna Clara Scheid (* 11.10.1795 in Heistenbach, + 27.9.1846 in Holzheim). Das Ehepaar hatte folgende Kinder:
- Friedrich Wilhelm (* 3.10.1822, + 4.10.1822)
- Johann Wilhelm (* 7.7.1825, + 1.8.1825)
- Catharine (* 13.1.1827)
- Johann Carl (* 6.5.1829)
- Johannette (* 3.7.1833)
Für keines der überlebenden Kinder gibt es weitere Eintragungen in den Kirchenbüchern.
Der Vater Von Conrad Mohr heiratete ein zweites Mal (Catharina Och aus Flacht). Aus dieser Ehe entstammt der 1809 geborene Johannes Mohr.
Carl Herborn – Auswanderungsjahr 1866
Nach dem von Karl Schughart zitierten Buch “Von Hamburg nach Amerika” war Carl Herborn (Arbeiter) bei der Auswanderung 1866 32 Jahre alt. Carl Herborn wurde als Sohn des aus Freiendiez kommenden Försters Johannes Herborn (* 14.1.1766 in Freiendiez, + 21.3.1853 in Holzheim) und der aus Flacht stammenden Anna Maria Horst (* 20.11.1796 auf dem Neuhof bei Philippseich, +18.11.1843 in Holzheim) am 24.11.1833 in Holzheim geboren. Für Carl Herborn ist keine Eheschließung in den Kirchenbüchern eingetragen.
Anton Gaul – Auswanderungsjahr ?
Es könnte sich hier um den am 30. 10. 1843 in Holzheim geborenen Sohn (Wilhelm Anton) von David Gaul (Landmann und Gemeinderechner) und Anna Margaretha Koch handeln. David Gaul war in 2. Ehe mit Elisabethe Langschied aus Birlenbach verheiratet. Die zwei Töchter aus erster Ehe heirateten Anton (1871) bzw. Daniel Heinrich (1876) Langschied aus Birlenbach. Weitere Mitglieder aus der engeren Familie von David Gaul wanderten ebenfalls in die USA aus.
Biermas – Auswanderungsjahr 1870
Am 1. 3. 1822 ist die Geburt von Johannes Biermaas aus Holzheim eingetragen (Bd. 11, S. 14).
Seine Eltern waren der aus Holzheim stammende Kuhhirte bzw. Tageloehner Wilhelm Biermaas/ß und Dorothea Reichel (Tochter des Philipp Reichel und Elisabetha Kretzer aus Holzheim).
Für folgende Geschwister von Johannes sind Geburten eingetragen:
- Anna Maria, * 28.2.1813, + 18.8.1813
- Conrad, * 19.11.1816
- Wilhelm Anton, * 4.12.1818
- Johann Georg, *28.2.1821, + 10.3.1821
- Catharine, * 6.9.1824
- Philipp, * 18.3.1827, + 14.3.1828
Laut den Heirats-Buechern fuer Holzheim war Johannes Biermaas (Beruf: Leineweber) zwei mal verheiratet.
Die erste Ehe wurde am 4.2.1844 mit Anna Maria Schug, (* 12.5.1816 in Birlenbach, + 6.9.1850), Tochter von Philipp Schug und Elisabetha Ruhl, geschlossen.
Fuer das Ehepaar sind folgende Geburten eingetragen:
- Jakob Wilhelm, * 13. 10. 1842 in Birlenbach, verh. 1869 m. Elisabethe Wolf (4 Kinder)
- Johannes Christian , * 29.7.1845
- Johann Wilhelm , * 13.12.1846
- Johann Philipp, * 23.4.1849, + 17.5.1849
- Wilhelmine, * 25.8.1850
Die zweite Ehe wurde am 21.9.1851 mit Anna Maria Jung (* 10. 7. 1817 in Hahnstätten, Tochter von Johann Friedrich Jung und Elisabethe Ullius) geschlossen.
Für das Ehepaar sind folgende Geburten eingetragen:
- Carl Heinrich, * 12.6.1852
- Friedrich Wilhelm, * 11.8.1854
Bei den ausgewanderten Bruedern des Jakob Biermaas handelt es sich vermutlich um Johannes Christian und Johann Wilhelm. Fuer die beiden Soehne aus der 2. Ehe gibt es jedoch auch keine weiteren Eintragungen in den Kirchenbuechern.
Gg. Koch mit Ehefrau Dorothea, geb. Seibel – Auswanderungsjahr 1859
Die einzige Heirat zwischen einem Georg Koch und einer Dorothea Seibel ist die folgende:
Johann Georg Koch (* 3.3.1798 in Holzheim) heiratete am 16.5.1819 Anna Dorothea Seibel (* 23.6.1795 in Holzheim).
Für eine Koch, Anna Dorothea, geb. Seibel gibt es am 18. 12. 1846 einen (Bd. 60, S. 2, Stb. 148) Sterbe-Eintrag.
Sie war eine Schwester von Caspar Seibel. Im Sterbe-Buch gibt es entweder bei dem Eintrag für seinen Vater Johann dez08t Koch (+ 11.9.1816) oder für seine Mutter Wilhelmina, geb. Scheid (+20.5.1859) mit der Bemerkung “4 Soehne, 1 in Amerika u. 1 Tochter” (s. H-5-448-41). Johann dez08t Koch hatte vier Söhne.
Johann Georg Koch und Anna Dorothea Seibel hatten folgende Kinder:
- Anna Margaretha, * 18.1.1819, * 5.1.1856, verh. m. 1. Seibel, 2. Gaul
- Georg Wilhelm, * 28.11.1822
- Wilhelmine, * 25.9.1825, + 27.6.1826
- Conrad, * 10.4.1827, + 12.4.1827
- Catharine, * 2.1.1829, verh. m. Johann Georg Hoffmann aus Herborn am 8.10.1848
- Wilhelmine, * 19.3.1832
- Caroline, * 19.8.1835, + 18.5.1840
Hier gibt es weiteren Klärungsbedarf.
Konrad Seibel und Klara Müller – Auswanderungsjahr 1790
Am 4.5.1794 ist in Holzheim eine Heirat zwischen dem 1793 verwitweten Conrad Seibel (* 11.11.1767 in Holzheim) und Anna Clara Müller (* 1.11.1774 in Holzheim) eingetragen.
Für Personen dieses Namens (Ehepaar) gibt es jedoch Sterbe-Eintragungen (1825 und 1828) in Holzheim. Dies scheint in den Kirchenbüchern Flacht die einzige Heirat von Personen dieser Namen im fraglichen Zeitraum zu sein.
Das Auswanderungsjahr erscheint ungewöhnlich früh zu sein.
Wilhelmine Loos und Elisabethe Loos – Auswanderungsjahr 1840
Am 4. 3. 1838 ist eine Eheschließung zwischen dem Schäfer Johannes Loos (* 27.12.1812, + 9.3.1892) aus Holzheim und Barbara Kimmel (*17.9.1819, + 9. 4. 1897) aus Flacht eingetragen. Dieses Ehepaar hatte zwei Töchter mit den Namen Margarethe Marie Wilhelmine (* 16. 11. 1844) und Elisabethe Loos (* 12. 8. 1848). Sollte es sich um diese Personen handeln, so müßte das Auswanderungsjahr jedoch später liegen.
Diese Daten wurden zur Verfügung gestellt von Dieter Schwenk